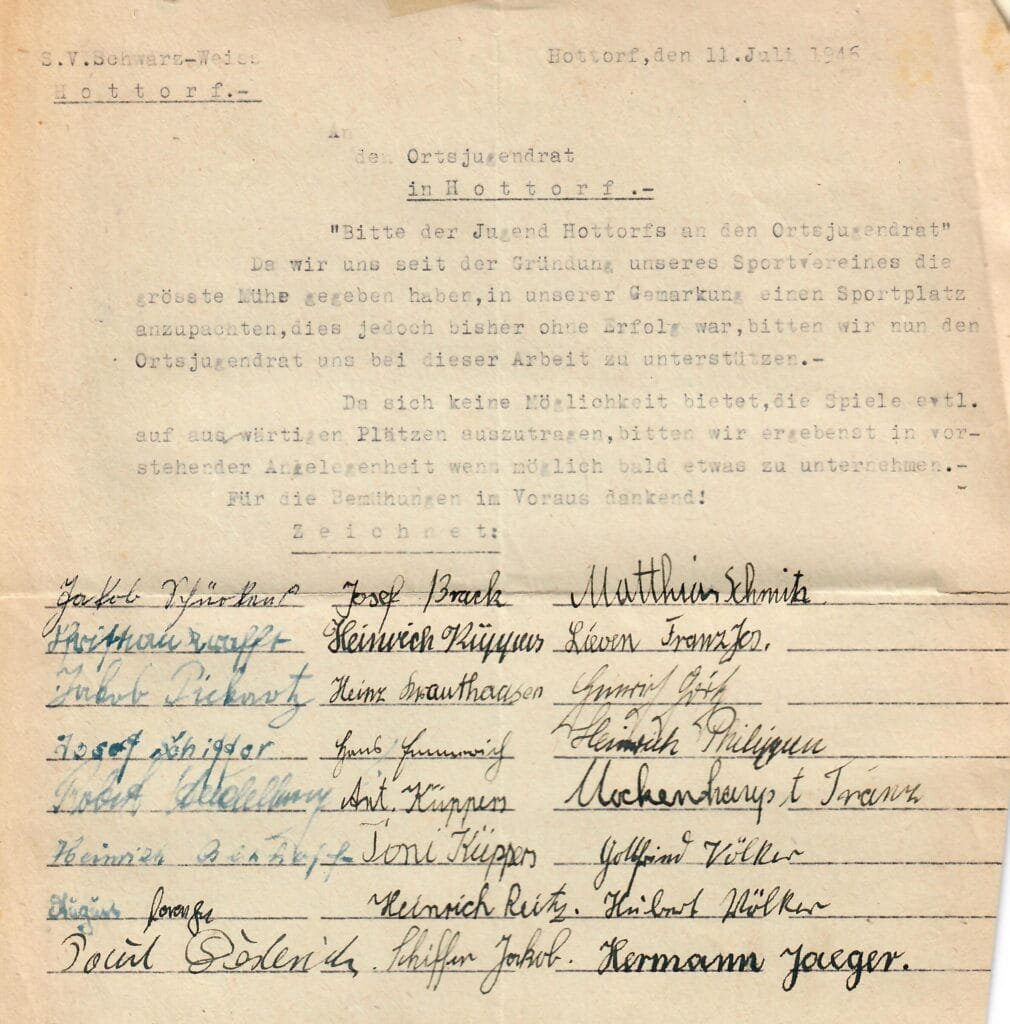Am 12.9.1944 wurde der Unterricht in Hottorf wegen Frontnähe eingestellt.
Die Kinder, längst an die Gefahren des Luftkrieges gewöhnt, suchten in der Mehrzahl schon nicht mehr über Tag den Keller bei Fliegeralarm auf; sie fanden die Schließung der Schule höchst überflüssig. Die Front rollte so rasch näher – in einer Woche würde alles vorbei sein, und der Unterricht würde dann in Kürze weitergehen – so glaubte man allgemein. Daß an der Rur sich der längste Stellungskampf dieses grausigen Krieges entwickeln würde und daß die Dörfer, so still und abgelegen, zerstört werden würden – das ahnte niemand.
Schon seit Septemberbeginn waren in jedem Haus einige Etappetruppen einquartiert; sie sahen äußerlich nach Ordnung und Pflege aus, aber leider lernte die Jugend und die breite Masse des Volkes rasch und krass gerade von ihnen, daß das Wort „stehlen“ – von Dieb schon gar nicht zu reden – aus dem Sprachgebrauch des deutschen Volkes entschwunden und der unschuldige Begriff „organisieren“ an seine Stelle gerückt war. Durchrollende Autos, mit Gepäckstücken hochbeladen, kündeten die zurückflutende Front an.
Das Dorfbild änderte sich jäh, als Masseneinquartierung kam. Die sogenannte „kleine Schule“, seit 47 Jahren nur von einer Lehrerin bewohnt, wurde, da sie weit und geräumig war, zum größten Truppensammelplatz. Am 17. September wurde Haus Nr. 2 mit 85 Schanzern belegt, Gerichtsbeamten aus Siegburg, alle gut gekleidet, obschon sie behaupteten, ihre „letzte Montur“ angelegt zu haben, Helle Wäsche, dünnes Schuhwerk, Sommeranzüge, gepflegte Hände, die nie einen Spaten umfaßt hatten, das war die Ausrüstung, die diese Leute mitbrachten. Die beiden Richter erschienen im Jagdanzug und wünschten ein weiß bezogenes Bett, das ich ihnen lächelnd gewähren konnte – wie würden diese Menschen aussehen, wenn sie den „anhänglichen“ Jülicher Boden kennen gelernt hatten?
Am 1. Tag durften sie sich wohnlich einrichten, am 2. Tag hieß es, morgens um 6 Uhr aufstehen, 6 1/2 Uhr Kaffee holen, 7 Uhr Abmarsch; Spaten wurden verteilt, und fort ging’s an neue ungewohnte Arbeit. Um 10 Uhr morgens kamen schon die ersten Herren zurück; sie sollten 2 1/2 m Boden, 1,4o m tief, 0,80 cm breit auswerfen und waren nach zweistündiger Arbeit schon abgekämpft.
Am 2. Tag verlangten die Klügsten schon nach einem Arzt; sie wollten sich ein Attest ausstellen lassen, daß sie arbeitsunfähig seien; am 5. Tag war die Schar schon so bedenklich zusammengeschmolzen, vor allen Dingen so ganz ihrer Führer beraubt, daß an eine Weiterführung der Schanzarbeit nicht zu denken war und die Herren in die Heimat zu anderer Verwendung zurückverfrachtet wurden. Sofort rückten 50 Kölner Handwerker aller Zünfte an – die Sache bekam ein besseres Gesicht. Aus einigen Schulbänken wurde eine große Bank gezimmert, aus Einzelsitzen Schemel fabriziert, aus 2 überflüssigen Türen und einem Tafelgestell erstanden Tische – die Skatecken waren fertig. Alle holten bei Bauern neues Stroh – die Lager auf dem Boden wurden fester und höher. Diesen Leuten war das Schanzen nur eine Nebenbeschäftigung, das Kartenspiel war die Hauptsache. Um 12 Uhr mittags hatten schon die ersten Handwerker die festgesetzte Menge Erde bewegt; die Arbeit war berechnet bis 5 Uhr nachmittags – dann gab es warme Suppe – aber bis dahin blieb keiner aus. Fast alle Handwerker nahmen sofort nach ihrer Ankunft eine gründliche Reinigung vor.
Bis zur NSV-Suppe mußten die Obstbäume des Dorfes daran glauben, und bei diesen Streifzügen lernten sie auch die Gegend kennen. Nach der warmen Speisung begann gegen 6 Uhr das Kartenspiel – aber Punkt 10 Uhr wurde die Notbeleuchtung eingeschaltet, kleine blaue Taschenlampenbirnen, die in jedem Raum angebracht waren und auch bei Fliegeralarm brennen bleiben konnten. Ordnung und Ruhe herrschten im Haus – das wurde mit einem Schlage anders, als auch noch 15O Kölner-Hitlerjungen als Schanzen ins Haus kamen, 15O 14-16 jährige Burschen, führerlos, eine wilde, arrogante Horde, die Tag und Nacht keine Ruhe ließ. Dabei arbeite die Schar wenig – 2 Stunden Frühsport, nachmittags Fußballspiel, abends Umzug pfeifend und singend durchs Dorf. Es war eine Erlösung, als 2 Tage später noch 48 Frontsoldaten ins Haus kamen, eine Verpflegungskolonne, die hinter der Front liegende Ortschaften von Lebensmitteln zu säubern hatte. Diese Männer waren eine Hilfe, die HJ in Zucht zu halten.
Am Samstag, den 14. Oktober 1944 , morgens nach 10 Uhr, als die Jugend gerade vom Frühsport in die Klasse kam, flogen die ersten Ari-Granaten ins Dorf. Das Haus der Witwe Esser nebenan wurde getroffen. Ein Soldat, Ostpreuße, Vater von 9 Kindern, erhielt einen Splitter in die Halsschlagader, ein Hitlerjunge einen Bauchschuß – die beide wurden sterbend zum Hauptverbandsplatz nach Müntz gefahren. Ein Junge hatte beide Augen verletzt – die Burschen waren nur noch ein tobender Haufen, und noch während des Beschusses verließen die ersten mit ihrem Gepäck das Dorf; in 1 Stunde war die ganze Gesellschaft „heim zu Muttern“ verschwunden. Man hatte ihnen versprochen, nicht in Frontnähe zu kommen; man hatte ihnen das Wort gebrochen – nun durften sie auch treulos werden. Die alten Kölner Handwerker reichten auch Beschwerde ein; sie durften nach großen Streitigkeiten einige Tage später um Köln die gleiche Arbeit wieder aufnehmen. Aber es passiert wohl hin und wieder, daß man aus dem Regen in die Traufe kommt, so auch dies Mal. 350 Elsäßer OF Leute, deren Deutschtum sehr zweifelhaft war, amen als Ersatz. Sie standen unter Aufsicht verschiedener politischer Funktionäre in Zivil; kein Wort durfte über die politische Frage fallen, nichts über die militärische Lage, obschon die Geschütze schon Tag und Nacht ballerten – ein ekelhaftes Theater -. Die Lebensmittel wurden für die ganze Belegschaft auf dem Speicher verteilt, dauernd ging’s treppauf, treppab. Bei Fliegeralarm wurde mit Absicht die Verdunkelung abgerissen; immer gab es irgendwie Zank und Streit mit den Goldfasanen in Zivil. –
Die Front in Gereonsweiler! Da wurde es Zeit, daß die unheimlichen Gesellen rückwärts verlegt wurden, und nun wechselte fast täglich die Einquartierung – Frontsoldaten.
Aber die Gegend sollte noch nicht genug verschanzt sein; nun hieß es: Die Frontsoldaten zum Obegeschoß, das Untergeschoß wird mit 15O Russinnen belegt, die Schanzarbeit zu verrichten haben. Frauenpflege und Sauberkeit erfordert zivilisiertere Mittel als sie der Mann verlangt. Es war erstaunlich zuzusehen mit welch primitiven Mitteln sich die heimatentwöhnten Frauen und Mädchen zu behelfen wußten, aber es war auch ekelerregend und ein Beweis, wie tief die Führung des Kulturvolks der Deutschen gesunken war, die Frauen in diese Umstände einzwängte. Nachts lagen die Mädchen auf altem Stroh halbentkleidet, mit ihren Mänteln zugedeckt, aber trotz Posten schlich es schon in der 2. Nacht von oben nach unten und von unten nach oben, und nach 8 Tagen war die Unzucht und damit auch die äußere Unsauberkeit breit und offen.
Gegen diese Schmutzwogen war ich machtlos, gegen diese kleine herrliche Blüte des Rassegesetzes. Ich bat den Ortskommandanten, die Mädchen aus dem Haus zu entfernen; er gab mir zur Antwort, daß ein Privathaus sich mit Recht gegen die Ausländerinnen wehren würde, die Schule müsse diese Einquartierung behalten. – Das Beste für die deutsche Jugend! – Ein Teil der Soldaten sollte entfernt werden, dafür wurde der halbe Speicher mit Munition belegt.
Jeden Tag waren andere Flüchtlinge in den Zimmern, und während schon fast alle im Dorf packten, um nach rückwärts zu räumen, hatten wir noch oft nachts im Keller keine Ruhe, wo auf einigen Stühlen ein Lager bereitet war. Oben war ein Hexensabbat, in der Luft die Flieger wie Mückenschwärme – war’s ein Karnevals- oder ein Totentanz? Die Wege waren von den Panzerfahrten so schlecht geworden, daß die meisten Mädchen mit ihrem leichten Schuhwerk das Haus auch über Tag nicht mehr verließen. Seit dem 20. November wurde das Dorf von Zivilisten leerer und leerer, die Front war da.
Am Morgen des 22. erhielten die Russinnen den Befehl, 15 km weiter ostwärts zu schanzen, da sie als Frau zu sehr in der Gefahrzone ständen. Zwei große LKW‘s nahmen die Mädchen auf; die Wagen fuhren Ralshoven zu. Ich verließ mit den Mädchen das Haus, um nachzusehen, ob überhaupt noch ein Hottorfer im Dorf sei.
Wagen auf Wagen mit Flüchtlingen war die letzten Tage vorbeigezogen. Alle Häuser hatten in den letzten Wochen schon Flüchtlinge weiter westwärts liegender Dörfer beherbergt; daher kannten sie schon des graue Elend, in das sie jetzt selbst ziehen mußten. Ich hatte gerade die Eingangspforte zum Friedhof erreicht, als die Dachziegel meines Hauses mit jähem Sprung auf die Straße kollerten – die Heerbahn lag unter Artilleriebeschuß. Schnell in den Keller bei Gerwin Schmitz, das Haus war still und tot, da prasselten auch dort die Scheiben schon in die Straße. Nach einer halben Stunde ließ das Feuer nach – lebte die Mutter noch? Lebten die Soldaten noch, die in meinem Haus waren? Das Dach war zum größten teil abgedeckt alle Türen und Fenster mit Rahmen herausgerissen, 8 tote Russinnen vor dem Haus, verschiedene Verletzte, aber die im Haus waren, sind unverletzt geblieben, wie von einem Wunder behütet. Sie waren in dem hofwärts gelegenen Zimmer gewesen, als der Einschlag von der Straße her erfolgte, und lagen nun geistesabwesend im Keller. An ein letztes Einpacken war nicht mehr zu denken. Bis in die letzte Schrankecke waren die Schlammspritzer gedrungen, die Zimmerdecken kamen schon im Klatschregen herunter – da fuhr am andern Morgen die Mutter mit der Gulaschkanne nach Könighoven. Ich blieb noch 3 Tage in der leisen Hoffnung, daß die Front mich überholen würde; ich dachte bei dieser Motorisierung nicht an 3 Monate Stellungskrieg. Als ich mein Heim, daran ich mit Liebe gebaut hatte, verließ, hatte sich das sichere Gefühl, daß ich es nie mehr wiedersehen würde. Darum nun weg, weit weg in die unbekannte Fremde, weit weg von einem Kreuz, das ein Verbrecher für mich in der Heimat gezimmert hatte, so weit weg, daß ich nichts von der Heimat erfuhr, daß ich auf der Gesunden Basis leben durfte, auf der die anderen Menschen steh. Dieser Wunsch sollte mir in der Herrlichsten Wiese erfüllt werden. Das Flüchtlingsjahr wurde das Jahr der Sommerfrische meines leben. Es war eine beschwingte, tatenfrohe Zeit in einem großen Kreis geistreicher, guter Menschen. –
Zuerst gelangte ich mit meiner Habe bis Titz; dort zimmerte mir Herr Pastor Hillebrand aus Lohn 7 große Holzkisten. Jetzt war mein Gepäck fertig für die Fahrt, eine ganz unerwartete Hilfe. Für den Preis von 100 Zigaretten erhielt ich ein Fuhrwerk bis Königshoven. Es war schwer, in dem Flüchtlingsstrom die Mutter zu finden, aber dann ging’s zu zweien an den Flüchtlingszug nach Bedburg.
Im Organisieren waren die Braunen groß, für Mütter, Kinder, sogar für etwaige operative Eingriffe war bestens Vorsorge getroffen. Der Zug wurde mit 1.7oo Menschen geradezu vollgestopft. Schon nach kurzer Fahrt mußte der Zug vor Gladbach einen ganzen Tag an einer Baumschonung wegen Fliegerbeschuß halt machen, und dann begann die 60 stündige Fahrt in den kalten Wagen. Zwar wurde täglich warmes Essen hereingereicht, aber strapaziös blieb die Fahrt doch. In Calbe/Saale wurden wurden wir ausgeladen; Mutter und ich gelangten mit 100 andern Flüchtlingen des Jülicher Landes nach Brumby, einem reichen Dorf der Magdeburger Börde von 2500 Einwohnern ev. Glaubens. Die Hauptlehrerin des Ortes, Frl. Charlotte Hohmuth, nebenbei das begabteste, gesegnete, innerlich reichste weibliche Wesen, das mir das Leben gezeigt hat, spannte mich sofort in die Betreuung der Flüchtlinge ein und brachte mich selbst bei dem Bauern Otto Becker unter, der für seine 3 Kinder 3 Höfe von 25o Morgen besaß.
Nach 14 Tagen hatte ich die Abordnung für Brumbyer Schule in der Hand und erhielt folgenden Stundenplan: 8-1O I. Jg., 68 Kinder, 1O-12 II. Jg., 63 Kinder, 12-1 I. Jg. , 48 Flüchtlingskinder.
Das Schulehalten sollte eine Überraschung sein. Die Brumbyer Kinder waren bis auf einige Versager so begabt, daß ich in einem Vierteljahr so viel Stoff bewältigen konnte wie in Hottorf in 2 Jahren. Die Jugend drängte ordentlich nach vorn, das Lernen war eine Last, aber es kamen auch Frechheiten vor, die in der Heimat nie gewachsen wären, und die einer harten Faust bedurften. Dabei waren sowohl Schüler als auch Eltern von einem Arbeitseifer, daß man nicht genug Anleitung zu häuslichen Aufgaben und Übungen geben konnte. Das Gegenspiel war die letzte Stunde. Die Flüchtlingskinder stammten zum größeren Teil aus Essen, und ich weiß heute, daß eine Versetzung nach Essen-Stadt einer Strafversetzung nach Deutsch-Sibirien gleichkäme. Im 1. Jg. saßen 12 jährige, nicht aus Dummheit, sondern aus Disziplinlosigkeit: 40-50j % Versäumnisse monatlich, dreist, faul, schon sehr jung sinnlich, ein Vorwärtskommen war unmöglich. Neben den saubern Jülicher Kindern, die wie ein Gruß aus der Heimat da saßen, fiel die körperliche Verwahrlosung unangenehm auf. An den Mützen prangte das Edelweiß, das Abzeichen der kommunistischen Jugend. –
Der 3. Jg., etwa 70 Kinder, und der 4, Jg. in gleicher Stärke wurden abwechselnd von Frl. Freyer Kieinecke betreut, die, religiös völlig uninteressiert, eine Lehrerin nach preußischem Schrot und Korn war, zuverlässig und ordentlich bis zum I-Tüpfelchen. Die Oberklasse, 5.-8. Jg., 98 Kinder, unterrichtete Frl. Hohmuth in einer Klasse, u. ev. mit solchem Geschick, mit solch prickelnder Begeisterung, mit einem solch inneren Reichtum, daß ich nichts als Verwunderung und Bewunderung war.
Jede Woche wurde ich einmal zu Kaffee und Abendessen zu ihr eingeladen, und diese Stunden waren so erfüllt von Geist und Verstehen und Liebenswürdigkeit, daß wir wie zwei Gestirne waren, die ineinanderstürzen mußten. Wenn ich sie betrachtete in all ihrer körperlichen und geistigen Schönheit, was mich dann immer im letzten Moment zurück, nicht die Balken des freundschaftlichen vertraulichen Du zu betreten? Ihr Nähe war Erziehung, soldatische Haltung, seelische Disziplin, geistiges Leben – und doch! Vom ersten Augenblick an verglich ich sie mit dem Königlichen Panther, mit dem ich lächelnd spielen konnte, aber ich fürchtete, ja, ich fürchtete die Krallen oder war es die Verschiedenheit der Weltanschauung, sie eine idealistische Nationalsozialistin, der Glaube an Deutschland bedeute Religion, ich eine Feindin des heuchlerischen Gewaltsystems, das nur leeres Phrasengetrommel und leere Götzen hatte? Nein, dieser Gegensatz war es nicht, wir versuchten ineinander Berge zu versetzen und trafen uns dabei; ich fürchtete die Krallen des Panthers, die ich selbst nie erfahren, wohl aber in kurzer Zeit erleben, daß sie sich mit diesen Krallen selbst zerfleischte. –
Durch Frl. Hohmuth lernte ich auch das Dorf kennen, stellenweise ein Bild aus Richters Zeichnungen, stellenweise ein Bild moderner Zivilisation: die breiten gepflasterten Straßen und Plätze mit den dicken Akazienbäumen, die betont geräumigen Wohnungen der reichen Bauern, mit allem Pomp ausgestattet, die flachen kleinen Häuser der Knechte, die alten Rittergüter, die schöne Kunstwerke bargen.
Durch meine Gastwirtin, Frau Annemarie Becker, wurde ich zu den Advents-Leseabenden zu Familie Ministerialrat Lahr mitgenommen, wovon der jüngste 32 jährige Sohn seit einigen Wochen in Brumby als ev. Pfarrer amtierte, und so war die ganze Familie dem Bombenhagel in Berlin entronnen und hatte in dem großen Pfarrhaus in Brumby ihre Zelte aufgeschlagen. Die Mutter war einer echte weltgewandte Französin, aber ebenso der Vater ein deutscher Mann, der Pfarrer ein Gemütsmensch von zuchtvoller Haltung, die Tochter eine tüchtige Zahnärztin, der älteste Sohn. Oberregierungsrat und z. Zt. In Hitlers Hauptquartier Ordonenzoffizier, ein sachlicher Beobachter, in politischer Hinsicht von starker Zurückhaltung der aber durch seine Charakterschilderungen der Größen des Dritten Reiches und durch manche Anekdoten die Neugier aller Zuhörer reizte.
Ferner traf ich bei diesen Mittwochs-Leseabenden an: die beachtliche und beachtenswerte Familie von Schwerin-Krosigk, die vor dem Einmarsch der Russen im Juni 1945 nach Wiesbaden flüchtete, ebenso die Familie von Trotha, die beiden Damen von der Osten sen. Und jun. Die im Juni auf ihr Gut nach Schleswig-Holtstein zogen, die zierliche, begabte Frau des Botschafters Krieger, die die Freiinnen von Plettenberg, Familie Coens, die ihr Anwesen von 10.000 Morgen so musterhaft verwaltete, daß das Gesinde sehr zufriefen war, die reichen Gutsbesitzer Ernst u. Wilhelm Ziemann, die ev. Pfarrer Stephani und Pensky mit ihren Frauen, selbstmehr Gelehrte als Pfarrer, verschiedene Studienräte und Studienrätinnen aus der nahen Stadt, und endlich traf ich einige Male als Freund des Hauses Lahr Ernst Theodor Haecke.
Die Adventsabende waren so schön, daß man die Beibehaltung der Leseabende beschloß.
Ich kramte aus den reichen Bibliotheken meine Freunde hervor: Paul Claudel und Leon Bloy, Rilke und Michel Angelo Calderon und die noch lebenden gemütlichen Flamen.
Von selbst bekamen jetzt die Abende inmitten der ev. Gesellschaft ein kath. Gesicht und fast immer liefen die religiösen Streitigkeiten zu meinen Gunsten aus, da ich mit festeren Umrissen dienen konnte als die ev. Glaubensgenossen.
Durch diese anregende Unterhaltung ergab es sich bald von selbst, daß ich donnerstags mit Herrn Pastor Lahr die Predigt umriß und in ihren Hauptzügen aufsetzte, die dann samstags einigen Mitgliedern des Lesezirkels vorgelesen und die dann Sonntag mit großem Geschick und jugendlicher Begeisterung vorgetragen wurde.
Die Katholiken konnten jetzt ohne Bedenken die Predigt anhören, dafür hatte ich gesorgt. –
Bald wurden für dienstags Musikabende gewünscht, Sonntag war ich zum Theodor zum Abendessen eingeladen, bald lernet ich mit Pferden umgehn, und ich fuhr einspännig mit einer Jagdkutsche oder zweispännig mit einer großen Kutsche über Land, in die Stadt, durch den herrlichen von Trothaschen Park, in den Wald.
Konnte ein reichhaltigeres Programm der armen Flüchtlingslehrerin geboten werden, die überall liebenwürdig und ritterlich behandelt wurde? Konnte man irgendwo schneller den Krieg vergessen? Kein Alarm, keine Fiieger, kein Beschuss, kein Mangel, und überall nur Geist und Schönheit.
Bei meinen Gaswirten war ich bald Familienmitglied. Zuerst sehr ängstlich und mit großer Zurückhaltung aufgenommen, übergab der alte Herr Becker mir schon nach 14 Tagen die Buchführung, die erbis dahin selbst ausgeführt hatte, und nach weiteren 14 Tagen den Schlüssel zum Geldschrank.
Ansehnliche Summen sind durch meine Hände gegangen. Ich verkaufte z.B. 2.200 Zentner Spätkartoffeln zu 2,80 RM. Die Fruchtbarkeit der Börde ist noch größer als die des Jülicher Landes. Es wurde geerntet pro ha: 25O dz Kartoffeln, 28 dz Weizen, 30 dz Hafer. An Löhnen zahlte ich pro Arbeitswoche rund 500 RM aus. Es war mir eine Freude, die Deputate gut und gerecht zu verteilen. –
Zur Heimat hin hatte ich keine Bindung mehr. Nur die Rote Kreuz Schwester Katharina Herbergs, ein gutes, kluges Mädchen, das sich tapfer und offen zu mir bekannte und glaubend und liebend an mir hing, wußte um meinen Aufenthalt. Durch sie erfuhr der Ortspfarrer meine Anschrift, und so erhielt ich eines Tages von Herr Pfarrer Hubert Reiners die Nachricht, daß er eine Bücherkiste von mir durch Soldatenhilfe nach Fachhütte bei Giesenkirchen entführt hatte. Eine Bücherkiste? Wo waren die 14 andern, die über 2.000 Bände bargen? Wahrscheinlich auch durch Soldaten entfuhrt, aber nicht zur Sicherstellung! Gleichgültig! Das hier war eine saubere und darum beglückende Nachricht. Es gingen noch einige Grüße hin und her, bis die Landesbesetzung durch die Alliierten uns trennte, und so erfuhr ich denn, daß im Februar die feine Barockkirche in Schutt und Asche sank, daß Trommelfeuer auf dem Ort gelegen, daß noch Hottorfer Männer im Kampf gefallen waren. Und darunter immer: Frohe Grüße. Das war gut gemeint, aber, Herr P. Reiners, wenn Sie wüßten, daß ich in einer Lage bin, wo mir die Freude gar nicht aufgeht! –
Am 10. April machte der Amerikaner einen überraschend schnellen Vorstoß vom Unterlauf des Main über Hessen und Thürigen nach Sachen, und schon am 13. April wurde Brumby kampflos besetzt. Kampflos? Ja! Die weißen Fahnen flatterten ganz fröhlich und neugierig aus allen Fenstern, nur Frl. Hohmuth mußte zum Flaggen gezwungen werden. Die Liebe glaubt alles. Ihre Liebe zu Deutschland und zu den führenden Männern war so stark, daß sie noch immer entgegen aller Vernunft an den Sieg glaubte. Als dann aber am 9. Mai das schmähliche Ende kam, als die Männer sich um die Verantwortung drückten, als sie sah, daß deutsche Mädchen und Frauen sich den Ausländern gaben, daß die Jugend, die sie mit nationalen Idealen erfüllt hatte, zum Polenball ging, wurde sie bleich und einsam und verbissen. Sie begrüßte keinen mehr, sie kannte keinen mehr als mich allein mit der Begründung: O, daß doch alle kalt gewesen wären oder glühend! Aber sie waren alle lau, darum mußte der Führer unterliegen, darum ging Deutschland zugrunde. –
Brumby erhielt zuerst amerikanische, dann bedeutend angenehmere englische Besatzung. Unser Kulturkreis ließ sich im großen und ganzen nicht stören, ja, die sonnigen Pfingsttage, da wir Fahrten und Spaziergänge durch das schöne Land unternahmen, gehören mit ihren feinen Gesprächen zu den schönsten Erinnerungen meines Lebens.
Allmählich wurde das Gerücht lauter: Der Russe besetzt Sachsen. Das brachte Unruhe in die Bevölkerung, und einige Großgrundbesitzer verschwanden aus der Gegend.
Es mehrten sich Polenüberfälle auf große Bauerngehöfte, und in der Nacht zum 17. Juni wurde der Hof meines Gastwirts von maskierten Polen überfallen und beraubt. Wir wurden alle mit den Revolvern aus den Betten gestoßen, barfuß und im Hemd in einen kleinen Keller eingesperrt, woraus wir 14 Personen, erst gegen Morgen befreit werden konnten.
Alle Lebensmittel, Federvieh, alle Herrenanzüge, Schmucksachen, größere Summen Geld, alles Packmaterial, wie Tasche, Mappen, Koffer, Damenwäsche und Schuhe waren geraubt
Die Polizei, die sofort auf eine Spur aufmerksam gemacht wurde, tat nichts.
Auch meiner Mutter und mir waren viele notwendige Dinge abhanden gekommen. Meine Mutter hatte z.B. keine Schuhe mehr; man kann zwar anderer Leute Wäsche zurechtschneidern, aber man paßt nicht in jedermanns Schuhwerk. – –
In der Sonntagfrühe des 1. Juli, als die Engländer noch in ihren Betten lagen u. schliefen, rückten die Russen mit großem Tam – tam ein, dieselben Schrei- und Rüpellieder singend, die der Nat. Soz.gekannt hatte.
Gegen 11 Uhr morgens waren die Engländer mit aller Bagage verschwunden, aber 8 Tage und Nächte dauerte der Russeneinmarsch, unabsehbares Menschenmaterial.
Das war der letzte Stoß für Frl. Hohmuth!
An sie denkend, hatte ich einige Damen und Herren des Kulturkreises zu einem Freilichtspiel aus dem Stegreif veranlaßt. Das mußte ablenken! Aber sie saß wie abwesend da.
Als auf der Höhe des Spiels ein russisches Platzkonzert unsere Stimmen im abgelegenen Pfarrgarten übertönte, brach sie zitternd mit einem jähen Schrei zusammen.
Wochenlang schwebte sie zwischen Leben und Tod, und als sie wieder das Bett verlassen durfte, war sie blind und geistesgestört, und, wie mir die Ärzte der Bernburger Nervenklinik erklärten, es würden sich diese Anfälle wiederholen. Der Chefarzt sagte: „Sie wär so reich, daß sie ihren verwundeten Stolz und ihre verwundete Liebe wie ein vergiftetes glühendes Eisen in sich hineinbohren konnte. Sie wird höchsten noch ein paar Jahre leben.“ 32 Jahre alt, und in Dunkelheit versunken! Genie und Wahnsinn! –
Schon die amerikanische Besatzung hatte mich, da ich politisch unvorbelastet war, zur Hauptlehrerin ernannt. Der Russe griff noch schneller durch. Für Brumby wurden 6 Lehrpersonen ernannt. Die Oberklasse erhielt einen 4o Stundenplan, es kamen beispielweise 2 Std.. Chemie, 2 Std. Algebra, 4 Std. Fremdsprache, französisch, englisch oder russisch hinzu. Die deutsche und lateinische Schrift mußten gleicherweise gepflegt werden. Die Lehrpersonen wechselten im Anfang schnell.
Das russische Gebiet war durch starke Postenketten von der englischen Zone getrennt. Aber es geschahen unerfreuliche Dinge; die Haltung der Russen wurde drohend und undurchsichtig. Da gingen Frl. Lehmann und Frl. Kleinecke über die „grüne Grenze“. Herr Balla, ein 55 jähriger Schlesier, von Heimat und Familie losgerissen, völlig unbemittelt, hatte in seinem politischen Fragebogen verschwiegen, daß er in den letzten Wochen zum Major befördert worden war. Er wurde seines Amtes enthoben und in die Steinbrüche nach Staßfurt gebracht, wo er noch immer für 80 Pfg. Stundenlohn arbeiten muß, ohne Hoffnung, Frau u. Kinder wiederzusehen.
Als Schulleiterin fühlte ich mich für die Güte der Lehrpersonen für das liebgewordene Dorf verantwortlich, aber ich fühlte, daß die, die ich bei der Magdeburger Regierung gleichsam erhandelte, sich doch auf die Dauer nicht würden halten können. –
Inzwischen machte die Bodenreform „rasche“ Fortschritte. Die Gutsbesitzer, die noch im Land verblieben waren, fühlten sich unschuldig gegenüber den immer drohenden Anklagen der Presse von Raub, Ausbeutung und Erpressung. Sie glaubten, daß ihr Besitztum auf 400 Morgen reduziert werde.
Als auch der Bezirkspräsident unterschrieb, daß sie den Heimatkreis verlassen müßten, nahmen sie auch diese Nachricht noch geduldig hin. Einige Zimmer wurden versandfertig gemacht, die Koffer standen gepackt, man wartete auf den Tag der Ausweisung. Ich sehe noch Herrn Coene, wie er am letzten Sonntag seines Brumbyer Aufenthalts in der Kirche stand. Sein Ausdruck war Sammlung, höchste Innerlichkeit, Bereitschaft, Hochsinn und Demut in einem.
Nach dem Segen änderte seine Haltung jäh. Er zog die Brieftasche, legte einige große Scheine auf den Teller und ging dann fast gleichgültig wie ein Mensch, der fertig ist mit einer großen Bilanz.
Nachts gegen 2 1/2 Uhr wurden die Gutsbesitzer mit ihren Familien von Deutschen aus den Betten geholt. Sie mußten unter ihrer Aufsicht einen Handkoffer mit Leibwäsche und Kleidern packen, und dann brachte ein LKW sie zunächst ins Gefängnis nach Calbe, dann ging’s zum Lager nach Scnönebeck und von dort aus sollten sie nach Mecklenburg zum Siedeln auf 20 Morgen „verfrachtet“ werden.
Als Herr Wilhelm Ziemanns nicht sogleich öffnete, halfen Russen mit dem Gewehrkolben nach. Da rief Herr Ziemanns in russischer Sprache aus dem Fenster: „Ich bin 3 Jahre in Sibirien in Gefangenschaft gewesen; ich werde nicht noch einmal dahin gehn.“
Dann schickte er seine Frau, das Tor zu öffnen. Als die Kommunisten das Schlafzimmer betraten, hatte sich Herr Wilhelm Ziemanns erhängt. Der Tod war auf der Stelle eingetreten. Während des Tumultes entkam sein 19 jähriger Sohn im Nebel der Nacht; er ist seitdem verschollen. –
Als ich am andern Morgen in das Coene’sche Gut ging, angeblich um nachzusehen, ob noch schulpflichtige Kinder in den Betten seien, war schon manches Stück der Einrichtung verschwunden, obschon noch keiner der Arbeiter das Haus betreten hatte. –
Die Belegschaft der Großbauern wurde aufgefordert, sich zum Siedeln auf 20 Morgen zu melden, es meldeten sich im ganzen Dorf nur 8 Arbeiter und 1 Essener. Da wurden die Parzellen kurzerhand verlost, ebenso der ganze Viehbestand. Dabei kamen die lächerlichsten Zusammenstellungen heraus; so erhielt beispielsweise das Reitpferd des Herrn Coene eine 65 jährige etwa 2 1/2 Zentner schwere Witwe. – –
Unser Kulturkreis war zusammengeschmolzen. Außer Frau Becker und Familie Lahr war nur noch die Frau des Botschafters Krieger übrig geblieben. Eine geb. Freiin von Plettenberg, Schwester der Frau Coene, war sie mit ihren 4 Kindern von Berlin zum Schwager geflüchtet. Im Zuge der Bodenreform wurde ihr noch 1 Zimmer belassen, da sie von der Wohlfahrtsunterstützung doch nicht mehr Miete zahlen könne. Ihr Guthaben war eingefroren. Sie war nicht mitverhaftet worden, um ihren Gatten anzulocken, von dem noch jede Nachricht ausstand. So mußte aber auch Frau Krieger den Versammlungsabenden fern bleiben, da sie ihre Kinder nicht allein lassen konnte und dauernd fürchtete, von ihnen getrennt zu werden. –
War der Kulturkreis nur zusammengewürfelt worden, um mir eine Freude zu bereiten?-
Durch das Näherzusammengerücktsein entwickelten sich die Beziehungen zu Familie Lahr immer inniger; sie sind zu einer Freundschaft erblüht, der keine Trennung mehr schadet. – –
Einen Abend der Woche hatte ich immer für meine Mitflüchtlinge freigehalten. Wenn freitags die Becker’sche Belegschaft entlöhnt war, ging ich zu den Heimatlosen, zu den Menschen in der Fremde. Da mir die Fremde so viel bot, war ich die stärkste von allen. Wenn ich mittags um 1 Uhr mit den Flüchtlingskindern die Schule verließ, standen die Evakuierten bereit, mit auf den Acker zu fahren. Dann kam es immer noch zu einer Plauderviertelstunde. Freitagsabends kannten wir kein Auseinandergehn. Ich ließ jeden seine Heimat so golden wie möglich malen; ich ließ jeden klagen und wieder klagen über die Fremde; denn das erleichterte das Herz. Und dann wurde ich selbst heiter und sang mit ihnen. Klagen? Nein, klagen konnte ich nicht. Ich hatte keine Heimat in ihrem Sinne, und Hottorf, wo ich das letzte Jahrzehnt gearbeitet hatte, hatte mir am wenigsten Freude entgegengebracht von allen Orten, wo ich geweilt hatte. Dafür hatte ein gewissenloser Heuchler gesorgt, der an der Hand eines Verbrechers den Boden für meine Arbeit unterwühlt hatte, und Volk läßt sich bekanntlich leiten.
Aber in einem Punkt stimmte ich mit den Flüchtlingen überein: Brumby hatte keine kath. Kirche; es fehlte das Innewohnen Gottes, es fehlte das Mysterium des Altares. Das war unser aller große und immerwährende Klage.
Dezember 1944 war eine Abordnung Katholiken von Brumby nach Calbe gegangen, um den dortigen kath. Pfarrer zu bewegen, auch in Brumby hin und wieder Dienst zu tun. Für die Frühe des 2. Weihnachtstages wurde ihnen Gottesdienst zugesprochen. –
Die Kirche in Brumby ist eine große Wehrkirche aus dem 12. Jahrhundert. Auf einer Bergkuppe gelegen, grüßt sie mit ihren trutzigen Zinnen und dicken Mauern und dem starken Wehrturm, umgeben von der weiten Wallmauer, stolz in das Land hinein, Das Innere überrascht noch mehr. Acht Emporen, in 2 Stockwerken übereinandergelagert, ziehen sich an 3 Seiten hin. Die Balkone waren im Mittelalter Sitz der Bruderschaften, seit der Reformation waren sie zu Familienlogen der reichen Gutsbesitzer herabgesunken; heute stehn sie infolge der Bodenreform leer und verwaist.
Altar, Kanzel, Vorderfront der Balkone und Decke wurden in der Renaissancezeit erneuert, als das Land noch katholisch war. Man glaubt auch heute noch in einem kath. Kirchenraum zu stehn; nur das Fehlen des Ewigen Lichtes und wahrhafte Bankungestüme, die nur zum Sitzen und nicht zum Knien eingerichtet sind; bezeugen den heutigen Charakter der Kirche. Haben die Apostel dws Hauptaltars, die Evangelisten der Kanzel, die Christfiguren der in 90 Feldern kassetierten Decke, die Heiligenfiguren der 8 Emporen und der beiden Chorgestühle nicht aufgeschaut, als sich am Stephanustage 1944 die Kirche mit ungefähr 900 Menschen füllte, um sich zum ersten Male seit 400 Jahren zum hl. Opfer zu vereinen?
Nach 4 Wochen war der 2. Gottesdienst, und nun füllten ev. Christen die Emporen; Neugier hatte sie in die Kirche getrieben. Bei diesem Besuch des kath. Pfarrers wurde ausgemacht, daß alle 14 Tage nachmittags um 3 Uhr das hl. Opfer dargebracht werden solle.
Ich hatte schon die Gemeinschaftsmesse mit der aus allen Provinzen gesammelten Gemeinden eingeübt; nun führte ich im Anschluß an den Gottesdienst eine Singstunde ein, die sowohl von Katholiken als auch von Protestanten eifrigst besucht wurde. Um allen gerecht zu werden, wurde einmal ein Lied aus der Kölner, dann ein Lied aus der Diözese Münster gesungen und dann ein Lied, das den schlesischen Provinzen eigen war, und sie Protestanten sangen freudig mit.
Abe obschon jetzt alle 14 Tage Gottessdienst war, es war doch nur ein Gegrüßt-gemieden (?).
Wir Laien richteten selbst Andachten ein, aber die Kirche war eben doch nur ein Bethaus, kein Gotteshaus. Die Zusammenkünfte freitags schlossen wir meist mit einem Marienlied; wir nahmen uns vor, dem Feierstundeläuten um 11 Uhr vormittags und 6 Uhr abends wieder den Sinn des Engel des Herrn zu geben und für diese Zeit in jeder Arbeit inne zu halten, aber die Sehnsucht nach der Kath. Heimat wuchs in allen, bis auforaust8 in uns der gewaltige Chor: „Beglückt darf nun Dich, o Heimat, ich schauen.“
Der goldene Herbst war da, Hunderte von Obstbäumen trugen in den Becker’schen Gärten, im von Fruttsa’schen Park ihr schwere, reife Last; im Pfarrgarten quollen die Trauben, und die schönsten Früchte wurden in meine Hände gelegt.
Die Abendstunden vereinten uns am war Kamin, und des Werben der Freunde wurde immer inniger: „Bleib!“.
Gewiß, hier war ein ersehntes Leben, und dort war Kreuz, aber dort war auch religiöse Heimat, und dort war ein Leben, das seit 2 Jahrzehnten sein Geschick in Güte und Treue in meins verflochten hatte, und dort war Jugend, die an mich glaubte und auf mich wartete. Und das war nicht nur Glück, das war Verantwortung und Verpflichtung.
So meldete ich mich mit der Mutter zum Rücktransport in die Heimat. Jede Stunde, die ich noch bei den Freunden verleben durfte, war mir liebes Geschenk. —
Am 15. November schlug die Stunde des Abschieds. Die Liebe der Freunde umspülte mich noch einmal mit heißen Wellen. Auf Veranlassung von Frau Ministerialrat Lahr hatte jedes Mitglied des Kulturkreises ein wertvolles Buch mit einer Widmung für mich hinterlassen, zum „Aufbau einer neuen Bibliothek falls die alte verschwunden sei.“ Der Ortspfarrer schenkte mir dazu eine Federzeichnung seiner Kirche, die, wie er sagte, auf der Rückseite Worte trug, die man nicht aussprechen könnte.
Ich war von allem so verwirrt, daß ich die Schätze gar nicht beschaute, andern versprach, sie auf den Weihnachtstisch zu legen, wo sie wie ein helles Licht strahlen sollten.
Die Jungen und Mädchen hatten die Berufskameraden abschiednehmend auf der Straße mobil gemacht, ein letztes Lebewohl und auf Wiedersehen, und alles versank im Dunkel des getroffenen Herzens. – – –
„Immer 5 Personenwagen und ein Gepäckwagen!“ befahl die Bahnhofsleitung; „jeder Gepäckwagen muß von 4 Männern bewacht werden.“ So rollte dar Zug aus der russischen Zone der englischen entgegen. Bange Erwartung war in allen.
„Weferlingen – russische Endstation! Alles aussteigen! Im Marschtritt 1 km über die Grenze!“ Da wußten alle Flüchtlinge: Der Rücktransport war organisierter Raub. Jeder warf einen letzten Blick auf‘ seine letzte Habe. Schnell die Mappe mit den Papieren unter den einen Arm, ein Bündel Wäsche unter den anderen Arm geklemmt, reihte ich mich der langen Flüchtlingskolonne ein, die mit Revolverschüssen und Kolbenstößen über die Grenze getrieben wurde. Sorge und Schmerz im Herzen, Sorge um die Zukunft, Schmerz um manches Schöne, das ich mit der fraulichen Kraft des Gemütes erworben, und, wie die Rose erglühend im Kelch, ob seiner Schönheit vor andern Augen verborgen hatte, und das ich nun in schmierigen Händen wußte.
Auf der englischen Seite standen wir Tag und Nacht im weiten Hof des Lagers zur Entlausung, drei Nächte mußten wir draußen stehn, ehe uns der Zug über Oldenburg-Duisburg über den Rheinstrom fuhr, und dann waren wir am 20. November linksrheinisch.
Hier zeigte der Krieg sein grausiges Gesicht: Ruinen, Trümmer, Panzerwracks, Gräber am Wegrand. Das zerschossene Heimat-Dorf wirkte auf mich wie die höhnische Larve eines berauschten Narren.
Mein Heim?
Die Möbel von 7 Zimmern waren bis auf einige Bruchstücke gestohlen oder sinnlos zerstört; nur Familie Reitz hatte einen Schrank gerettet; selbst das Klavier seines Inhaltes beraubt, nur der leere Kasten gähnte mir entgegen.
Wie mir glaubwürdige Hottorfer berichteten, waren meine Möbel noch Ende Mai ziemlich vorhanden – also waren nicht feindliche Soldaten die Zerstörer -; einige Familien hatten, zurückkehrend, mein Heim benutzt und jetzt? Leer und verwüstet.
Und als ich die Frage stellte: „Warum habt Ihr meine Möbel nicht zusammengestellt und eingeschlossen?“ kam mir die alte Kainsfrage als Antwort: „Bin ich denn der Hüter meines Bruders? Ich habe mich nur um mich selbst gekümmert.“
Das war das Erschütterndste für mich. Zuerst wollte ich mich in pharisäerhaftem Stolz von allen abwenden, aber dann sagte ich mir, daß, wie dem Handwerker die geschickten Hände, mir die soziale Gesinnung als Rüstzeug beigegeben war, mich helfend und hütend allem Schwachen und Kleinen zur Seite und mich schützend zwischen alles Schuldige und den berechtigten Zorn zu stellen, und daß ich nur ein Aufgeld zu zahlen hätte, wenn ich diesem Helferdrang nicht nachgeben würde. –
Was aber das Schlimmere war, meine Dienstwohnung – eng mit dem Schulraum unter einem Dach verbunden – war mit 3 Familien allerletzter Wahl belegt, die kein Hottorfer freiwillig aufgenommen hätte. Das „hat der Feinol getan.“
Man sage nicht, in der Schule behindern diese Leute keinen, und die Kinder merken nichts davon. Die Jugend weiß wohl zwischen den Fehlern und Schwachheiten wohlmeinender Menschen und den Abgründen letzter Degeneration zu unterscheiden.
– So bin ich – ungefähr als die Letzte heimgekehrt – die Einzige im Dorf, der es nicht möglich ist, wieder ein eigenes Heim zu gründen und zu genießen.
Warum geschieht mir dies? Oder werde ich auch „ohne Beutel und Schuhe“ ausgeschickt, um doch, besitzlos, zu bekunden, daß mir nichts gefehlt hat, nachdem Brumby ein so kostbares Angeld gewesen ist?
Soll ich nach der Geborgenheit und Verborgenheit seit der Strafversetzung 1934 nun nach 12 Jahren wieder unbelastet hinausgeschickt werden zu größeren Aufgaben? –
Manches im Dorf wäre anders, wenn Herr Pastor Reiners eher nach Haus gekommen wäre; aber er konnte auch erst im September wieder nach Hottorf kommen. Manche Einwohner klagen Über Diebstahl der Nachbarn, und es ist schon so, wie manche sagen, daß der Herrgott Kriegssondergesetze und eine allgemeine Amnestie erlassen muß, bis die Nachkriegszeit wieder die Herzen und Heime in Ordnung bringt.
Durch den Ortsbürgermeister wurden Mutter und ich bei den Nachbarn Froitzheim untergebracht. Dort haben wir gute Aufnahme gefunden. Ein warmer Herd und das tägliche Brot – das sind die mächtigsten und beherrschenden Faktoren dieses Notwinters.
Vor den beiden ersten apokalyptischen Reitern, die heute durch die deutschen Gaue rasen, sind wir bei Froitzheim geschützt. Dabei lasse ich mich so gerne von der Schwester der Frau Froitzheim, Frl. Sehrey, im Dorf allgemein „Tant Traud“ genannt, betreuen.
Wer morgens schon vor 6 allein im Stall den Schweizer macht, die Feuer schürt und hütet, um die körperlichen Eigenheiten und Vorlieben von Mensch und Tier weiß, den Appetit der einzelnen weckt und deckt und selbst kaum Zeit zum Essen findet, weil er in Haus und Stall und Garten und Feld schuftet; bis er abends gegen 11 Uhr an den Betten steht und jedem eine „gute Nach“ wünscht, der ist keine weiche Tante, das ist eine harte, gute Tant.
Wenn es bloß die Körperkraft der 7o-jährigen wäre, aber wie sie alles tut! In Bereitschaft und Treue, in Selbstverständlichkeit und dienender Liebe und vor allen Dingen mit immerwährendem Frohsinn. Sie ist eine „Heldin des Alltags“.
Hottorf ist durch die sinkende Geburtenzahl einklassig geworden; Herr Lehrer Schulte ist wieder in den Dienst eingestellt. Aber wer zur Nazizeit aus politischen Gründen strafversetzt wurde, der darf auch jetzt wohl einen Wunsch äußern.
Ich möchte über diesen Notwinter bei „Tant Traud“ bleiben, besonders auch um mich langsam von den Kindern zu lösen, die noch immer und überall an mir gehangen haben. Dieser Wunsch wurde mir gewährt.
Nachdem die Militärregierung durch die Hand des Regierungsdirektors Herrn Dr. Deutzmann meine Zulassung zum Schuldienst gestattet hatte, bin ich seit dem 25. Januar wieder Lehrerin der 3 untern Jahrgänge in Hottorf.
Aber wohin nach Ostern, ohne Kleid für die warmen Tage, ohne Mantel, ohne Deckzeug für die Nacht?
Wenn die Sonne am Morgen aufgeht und die Strahlen über den Horizont schießen, weiß man noch nicht, ob der Tag blau oder so grau wird, daß Wolken das strahlende Gestirn verdecken. So zeichnet sich schon leise die Arbeit an einem Menschen, mit einem Menschen und durch einen Menschen ab; dem ich als größter, nachgiebigster, aufpeitschender Feind letzter Freund sein will – aber Gewißheit ist mir noch nicht über mein äußeres Geschick. Aber in mir lebt nicht die Hoffnung, sondern der Glaube an diese Sendung, ein Glaube, so stark, daß ich hoffe, in treuer Arbeit an mir selbst die Kraft und den Segen zu haben, über die engen Bezirke des Ich und des Du und den weiteren Kreis der Berufsarbeit in die Höhen und Tiefen der Menschheit hineingreifen zu können, um so am Ewig-gültigen, am Seienden mitwirken zu dürfen; denn das Geschick der Glaubenden und Liebenden gibt der Welt die letzte Formung und nicht der Waffengang Satans.
So gleiche ich der vor Saft überquellenden Traube, und wenn mir noch ein paar Herbstjahre die Gesundheit des Leibes verbleibt, hoffe ich, am Ende dem HERRN den liebenswürdigen Vorwurf machen zu können, daß er „den guten Wein bis zuletzt aufbewahrt hat“.