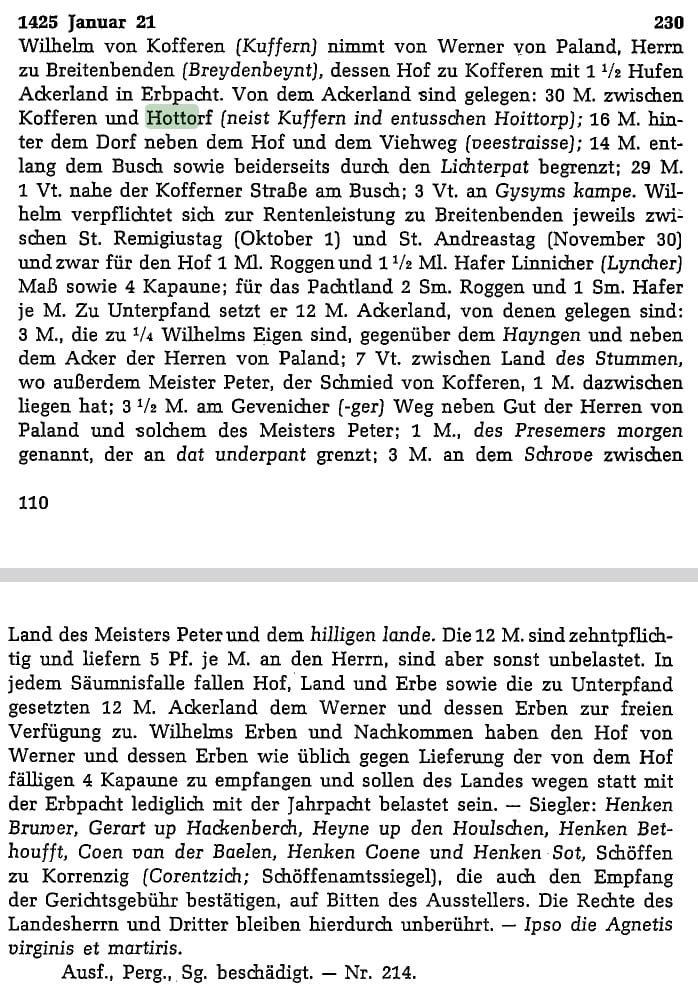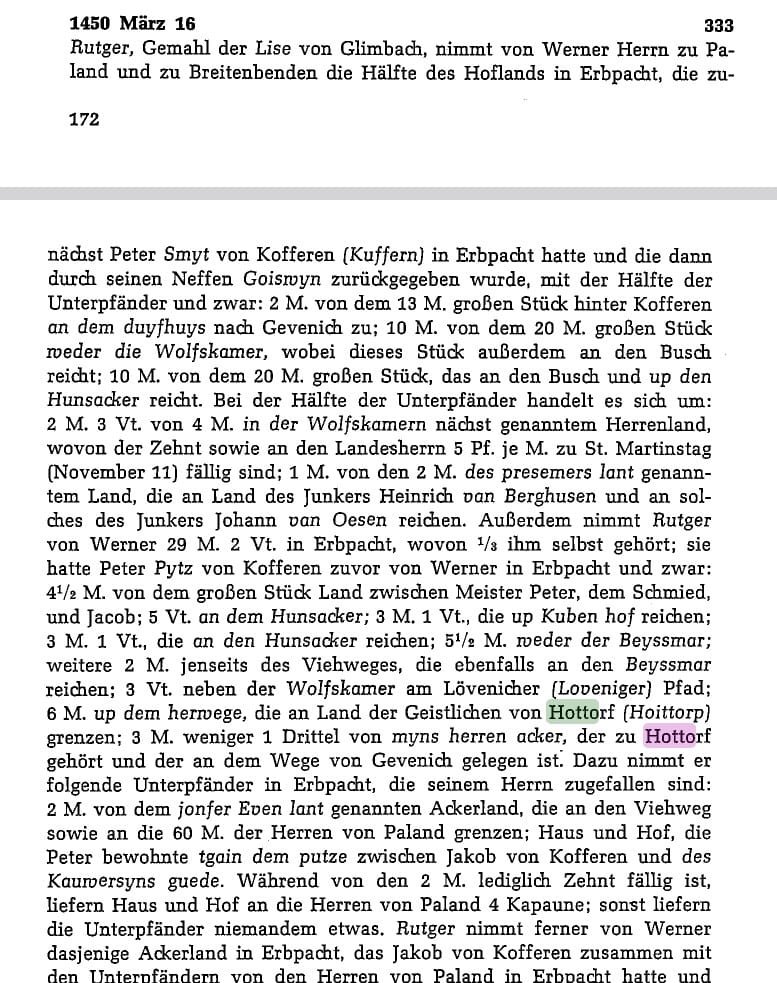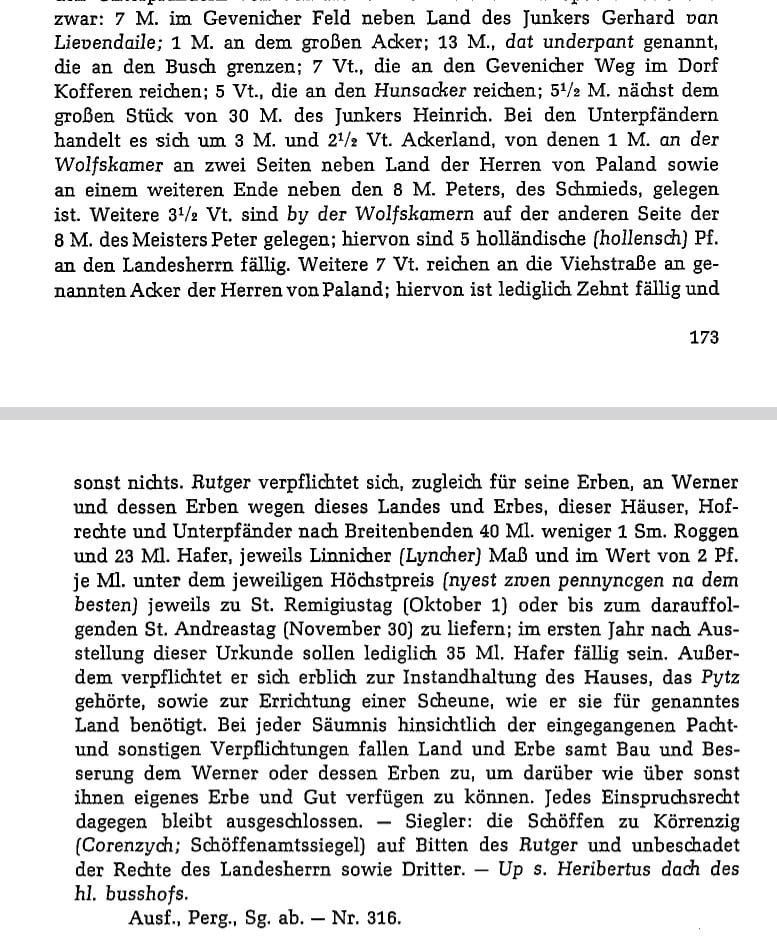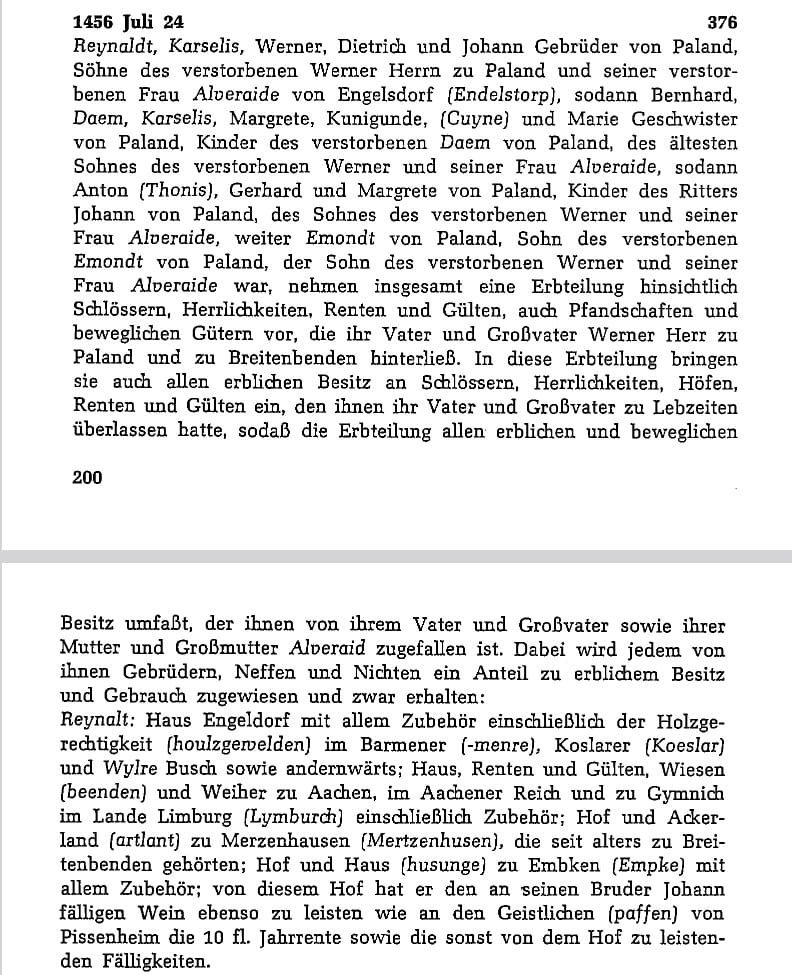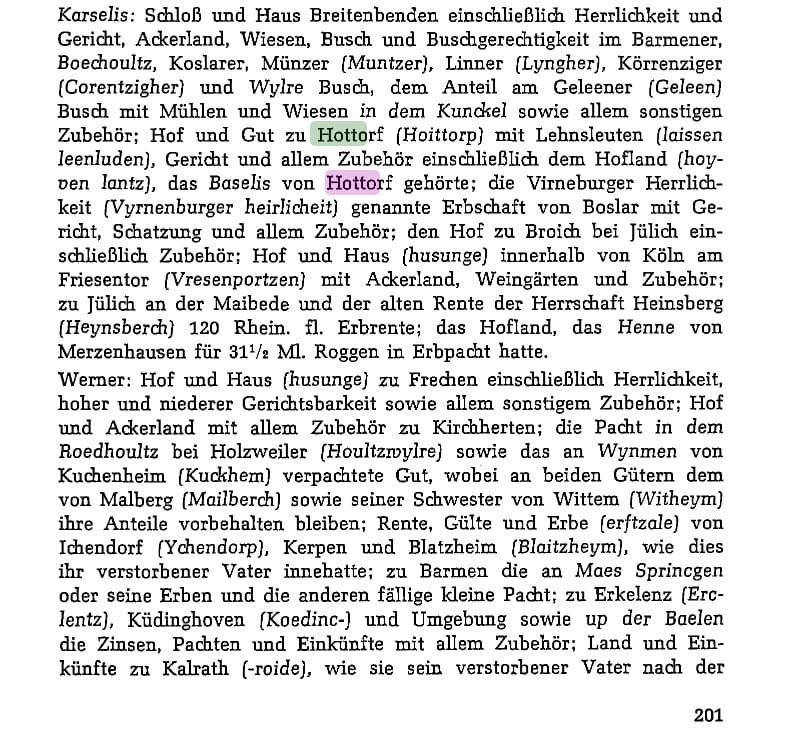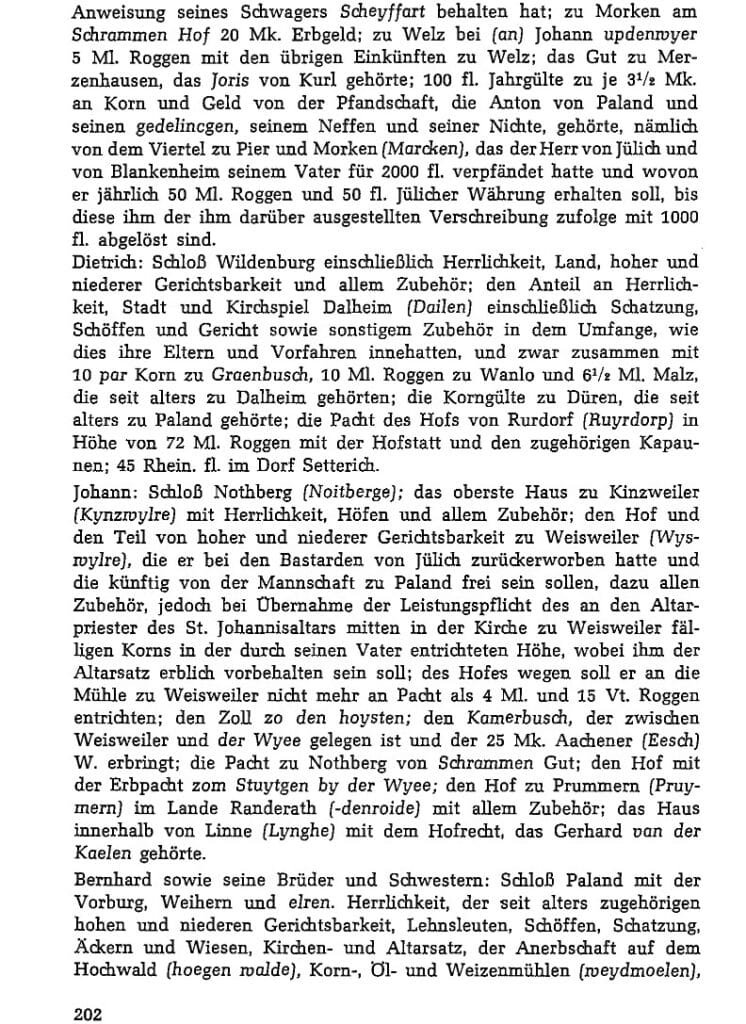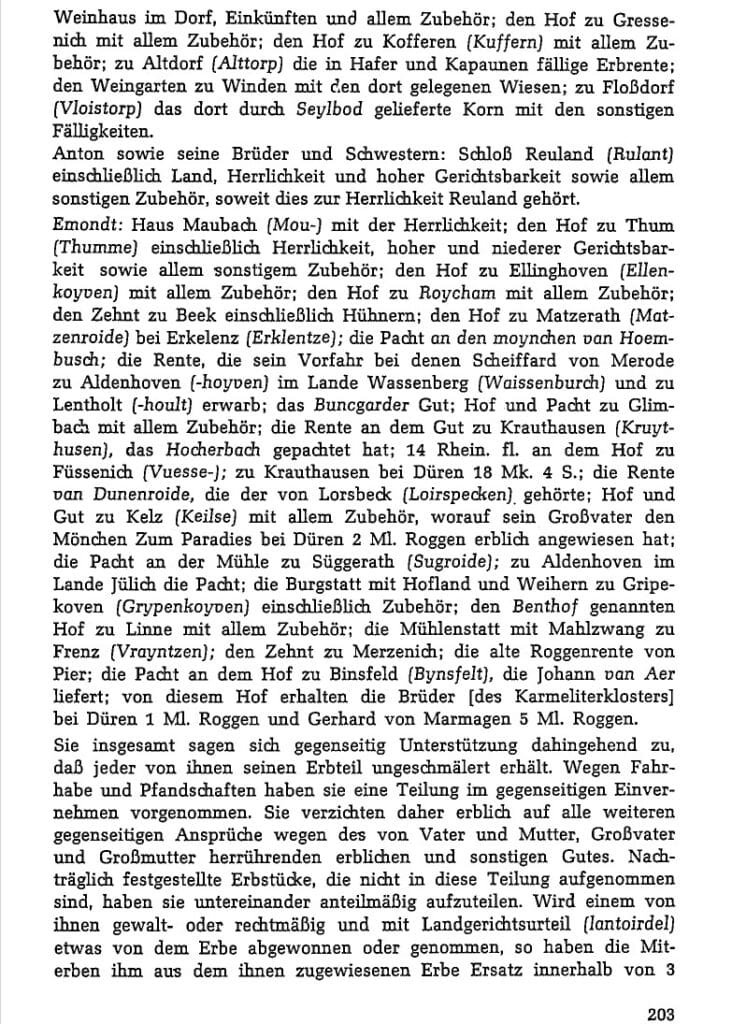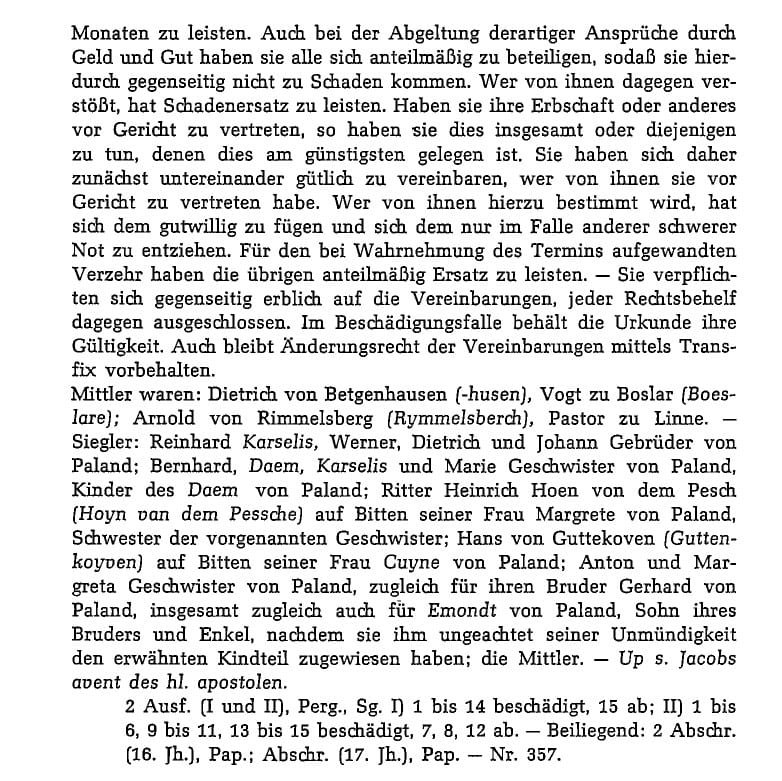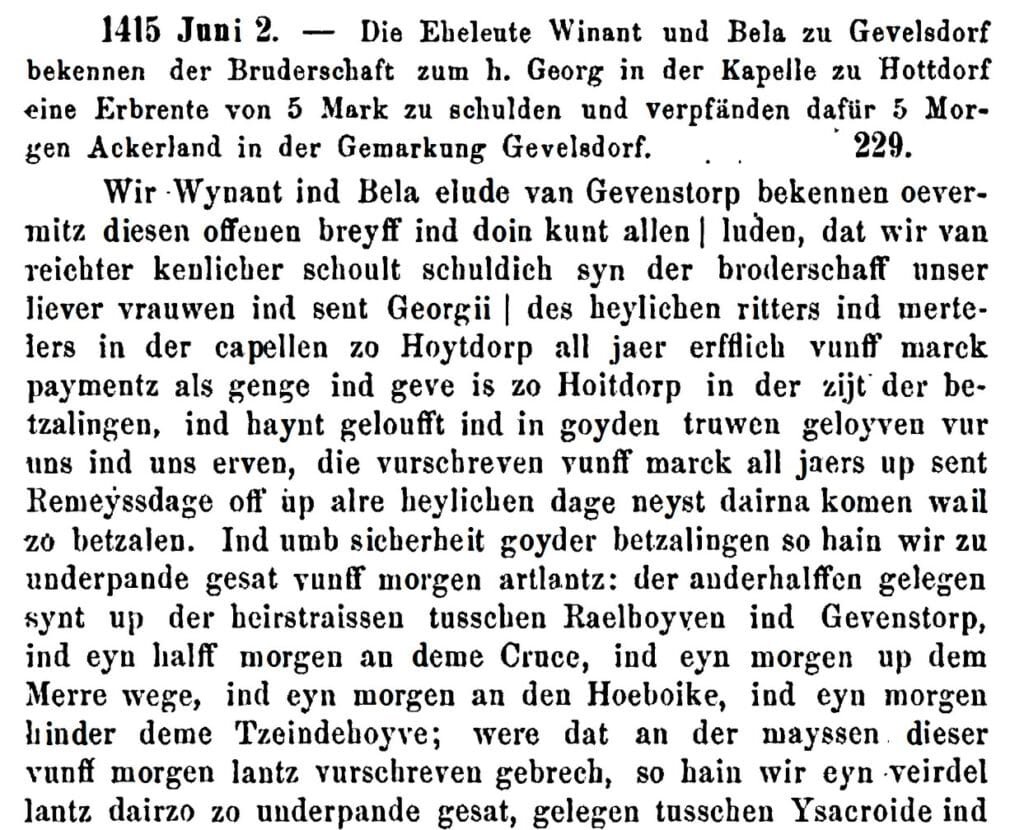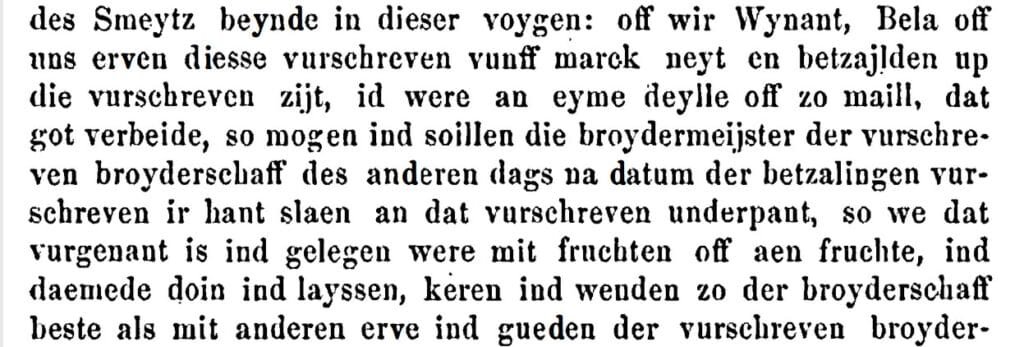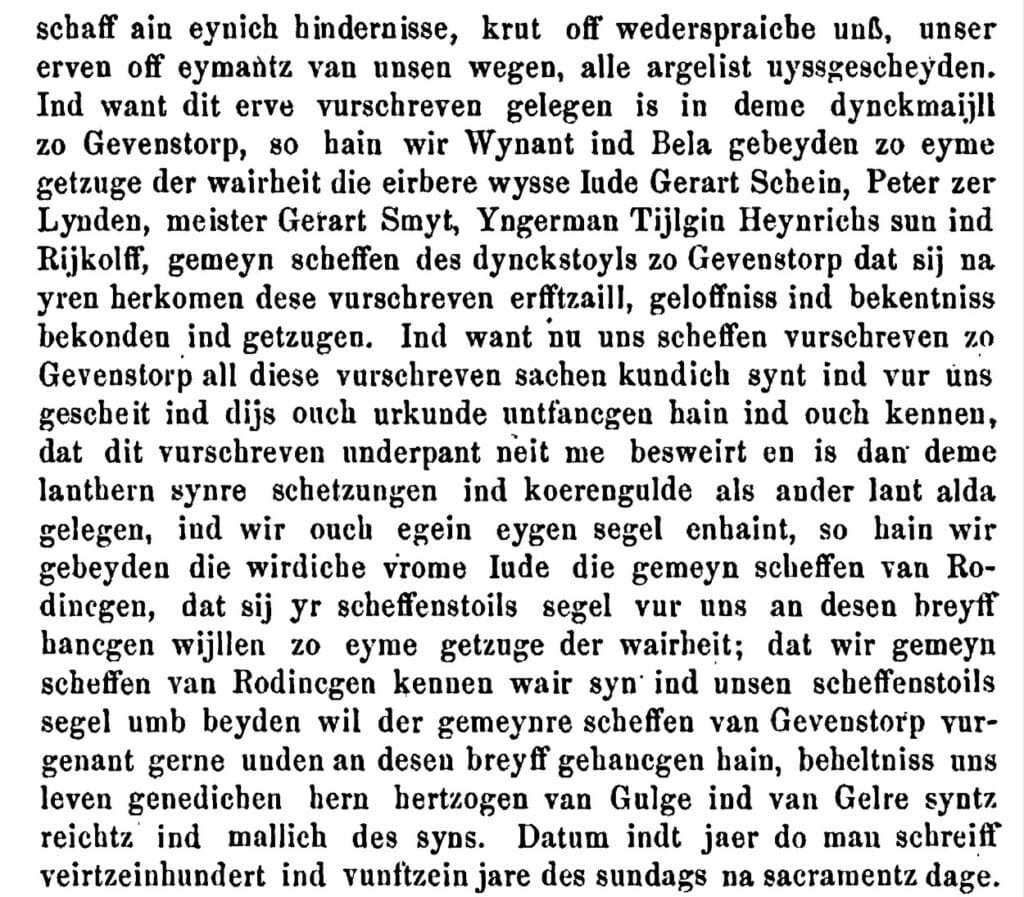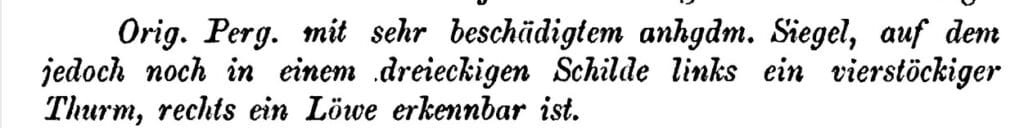Gotische Kapelle zerstört

| Weitere Urkunden beim Brand in Boslar zerstört |
In der Zeit von Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Kirche jedoch zerstört, vielleicht im dreißigjährigen oder im siebenjährigen Krieg (1618-1648 oder 1756-1763).
Damit endet eigentlich „Kirchengeschichte“ von Hottorf, denn alle vorhandenen Urkunden sind bis auf einen Teil bei einem Großfeuer in Boslar (nur vier von 120 Häusern wurden verschont) am 13. September 1803 verbrannt. Da Hottorf nur Filiaort von Boslar war, befanden sich die Urkunden und Niederschriften im Pfarrhaus von Boslar, welches auch ein Raub der Flammen wurde.
Quelle: Schiffer
Die Abfolge der Ereignisse (u.a. die von Oitdtmannschen Stiftungen von Fenstern, Altar und Kommunionbank von 1750 bis 1754 sowie die Schilderungen zu den Auswirkungen des siebenjährigen Kriegs im Rheinland) legt die Vermutungnahe, dass die Zerstörung im siebenjährigen Krieg – also um 1760, somit Mitte des 18. Jahrhunderts – erfolgte.