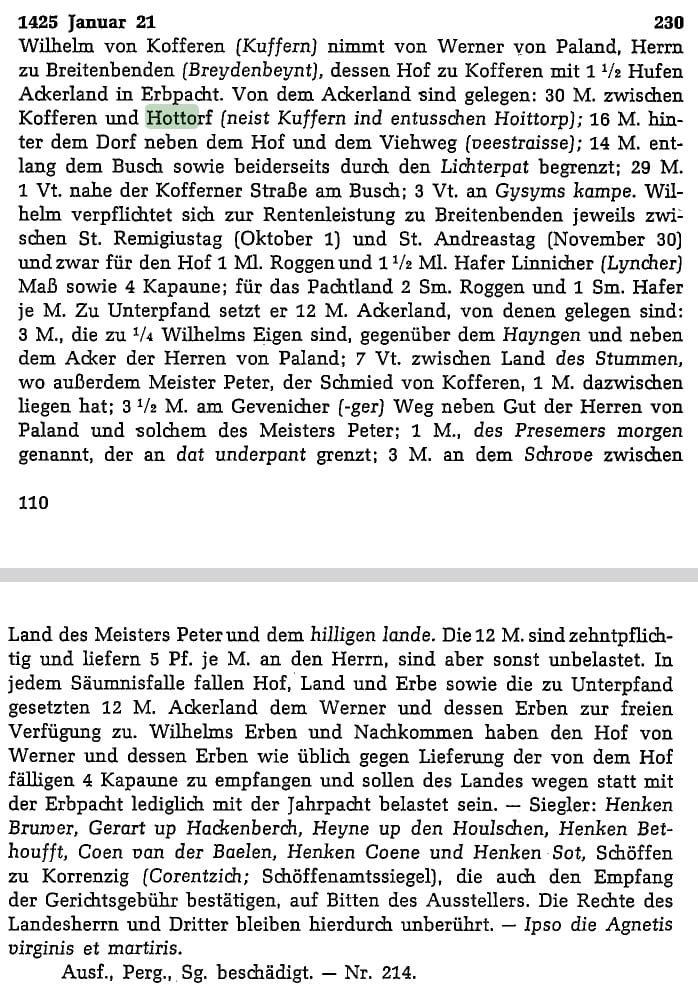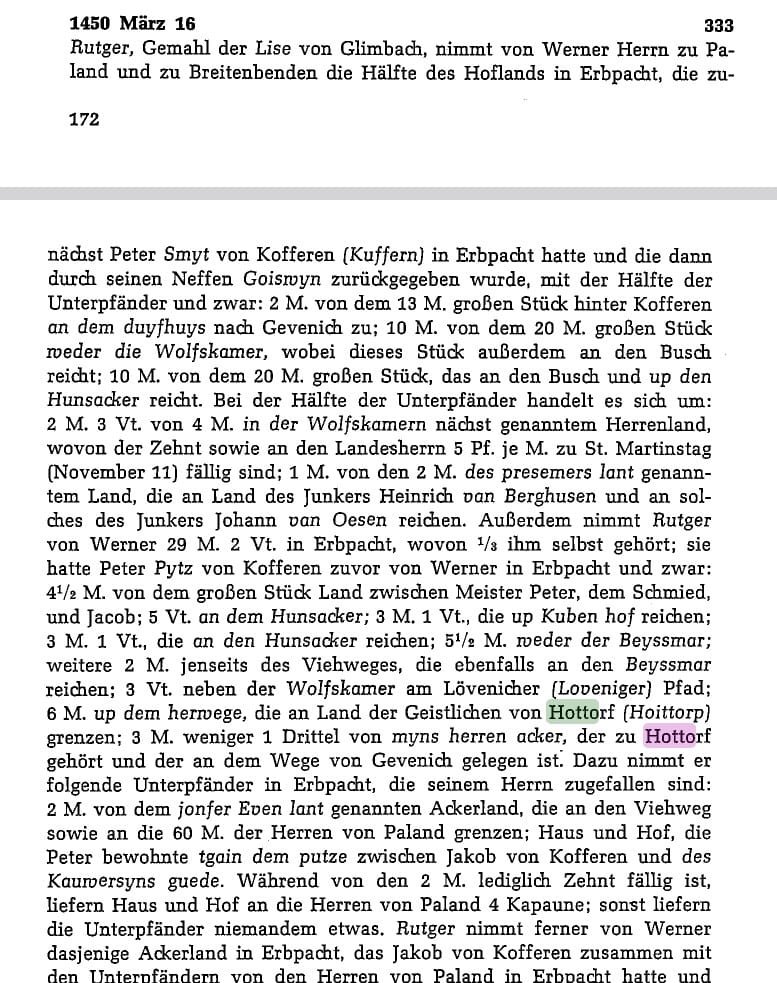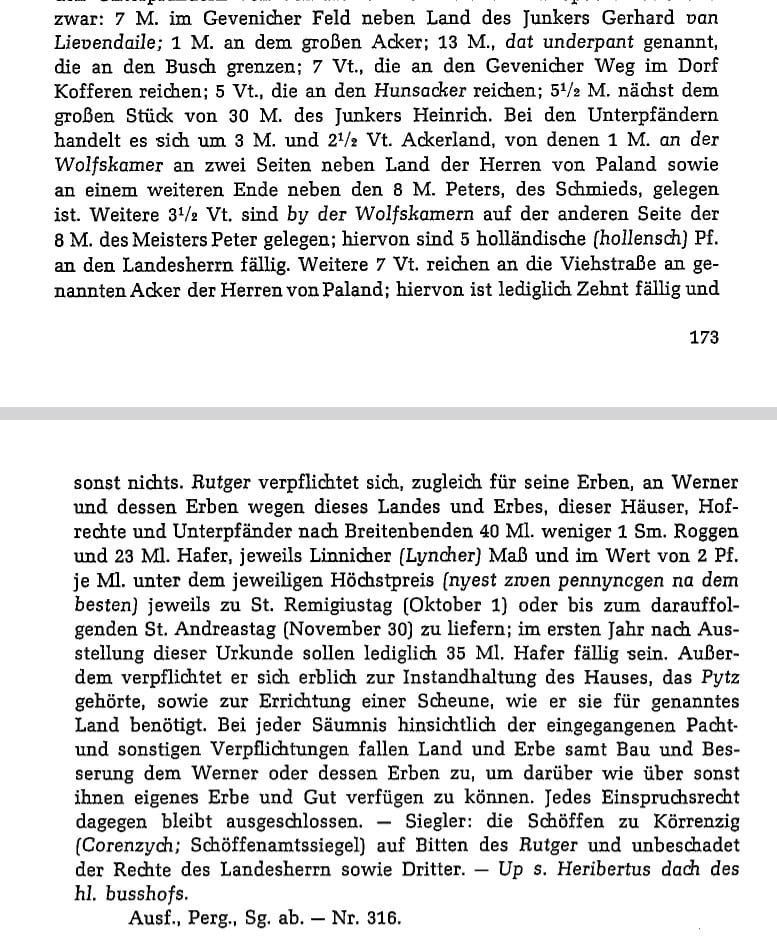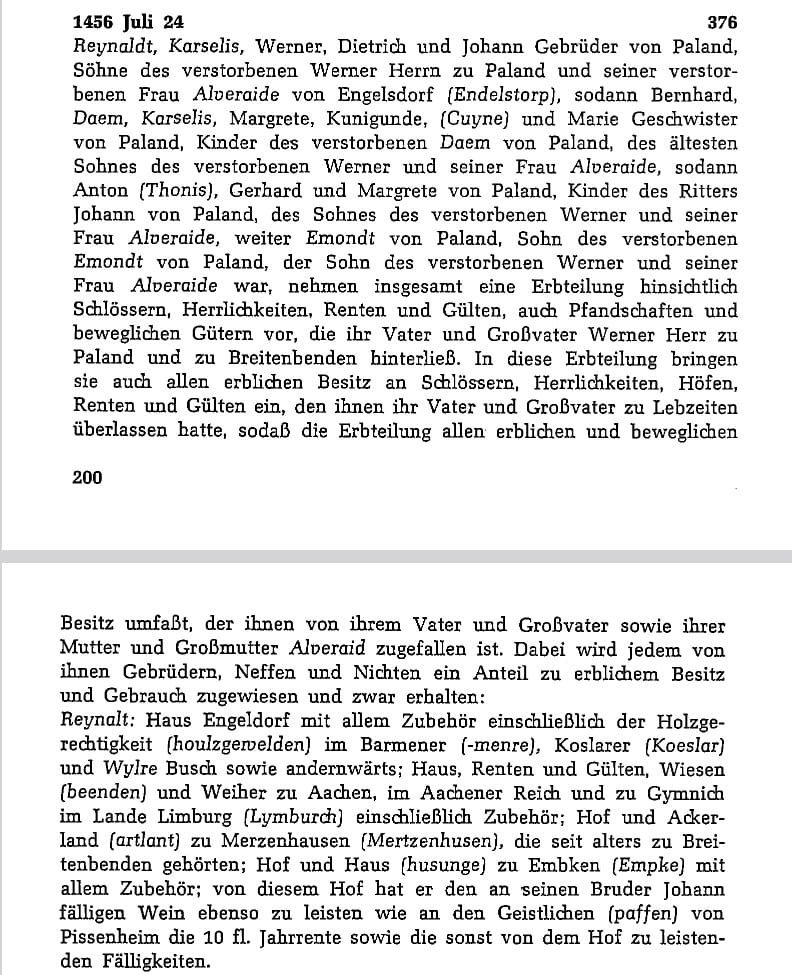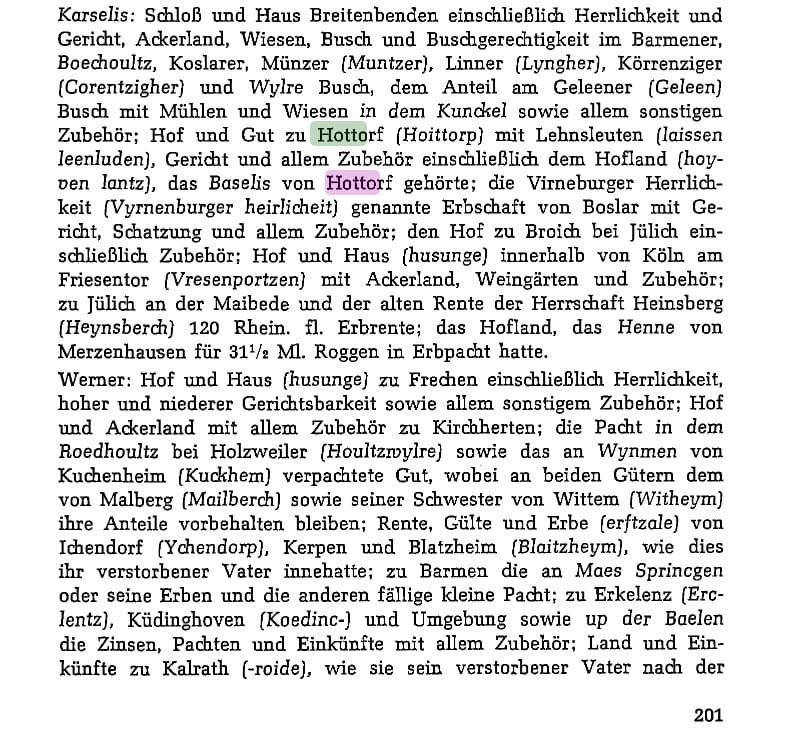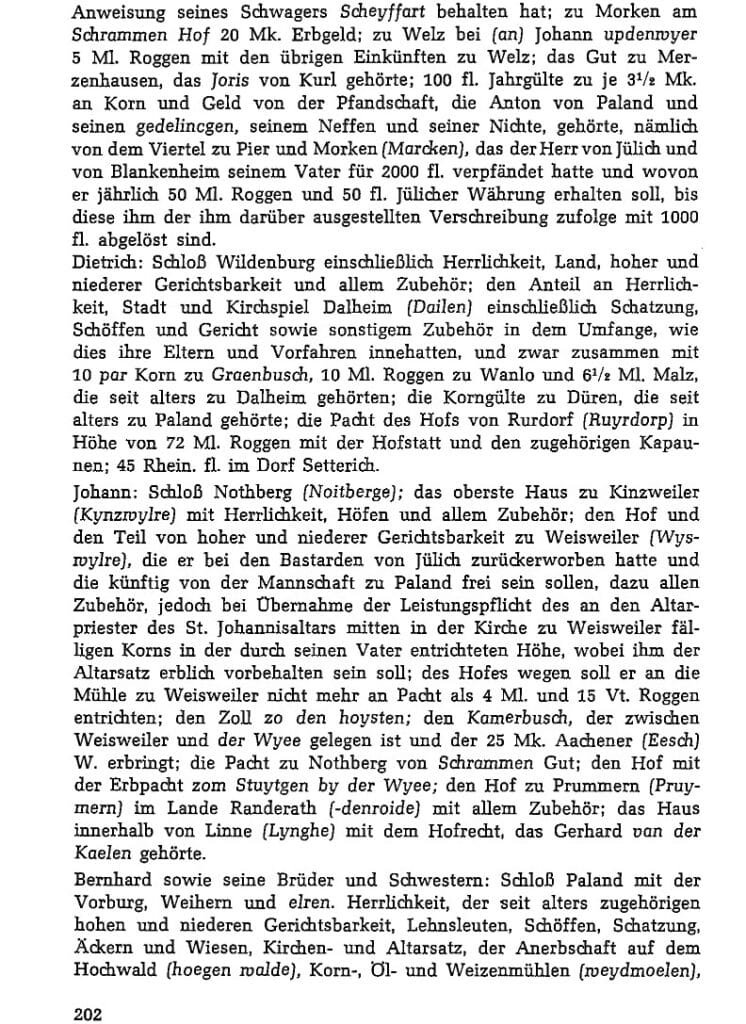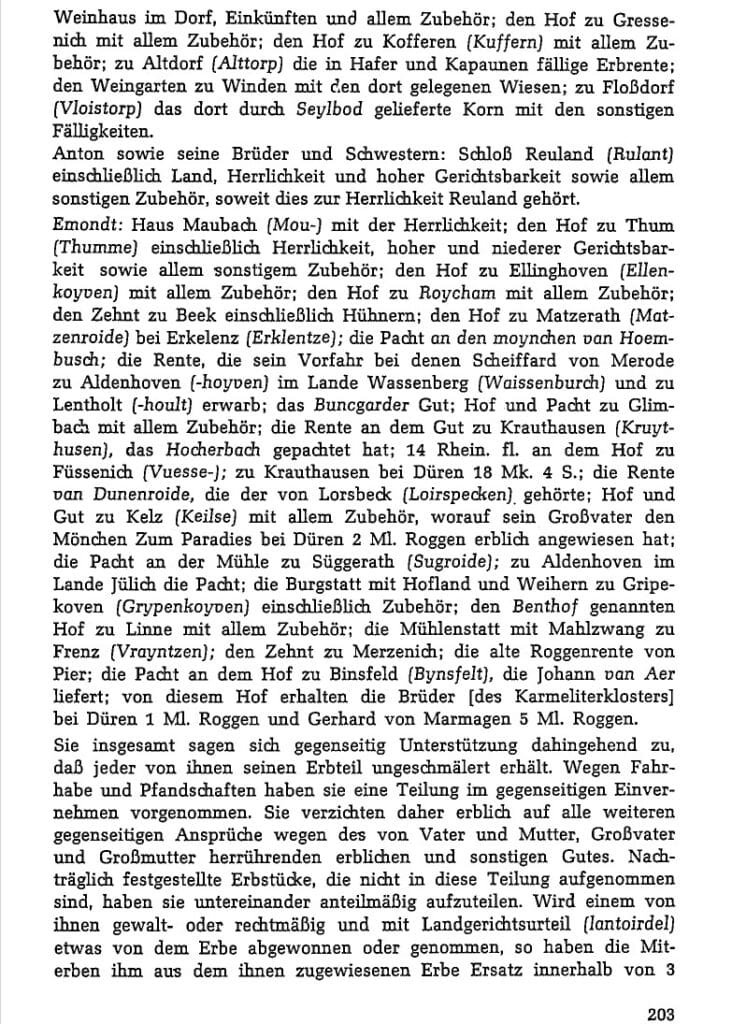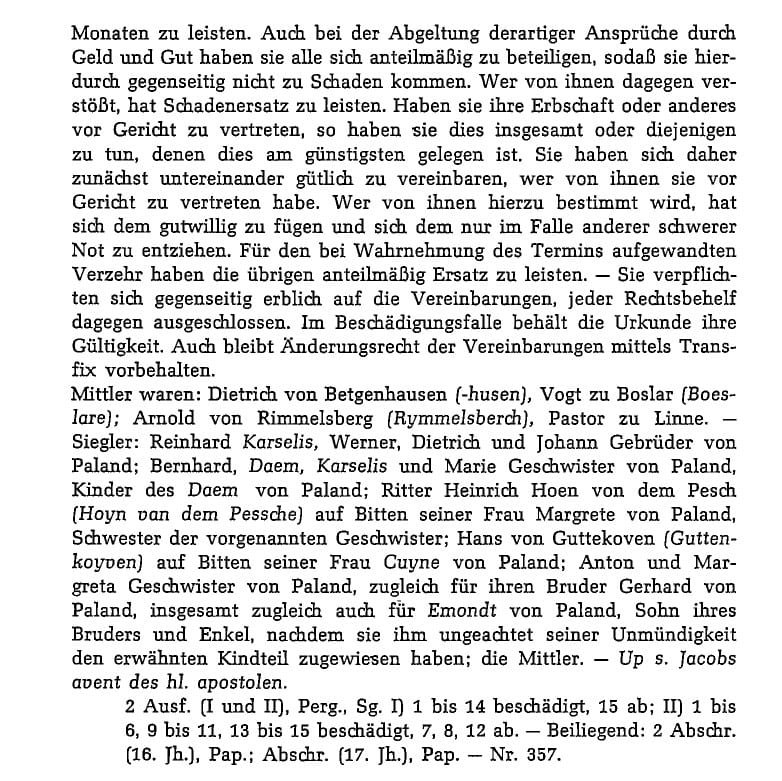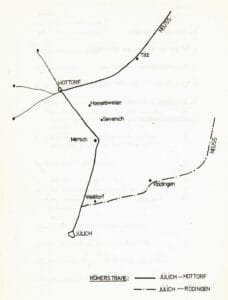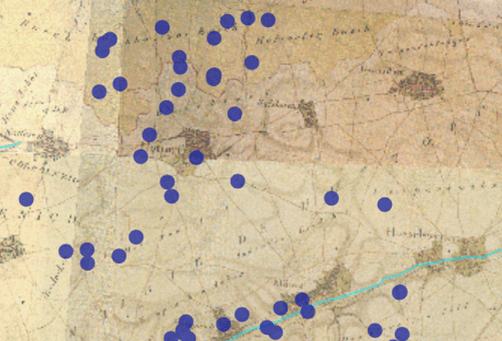Volkzählung 1767
31. Dezember 1767

| 364 Einwohner |
In den Rur-Blumen werden im März 1927 in einem Artikel zum 18. Jahrhundet die Ergebnisse der Volkzählung aus dem Jahr 1767 berichtet:
- Hottorf: 364 Einwohner
- Hasselsweiler: 365
- Müntz: 444
- Hompesch: 145
- Ralshoven: 112
- Boslar: 562
- Gevenich: 512
- Linnich: 1.018
- Körrenzig: 358
- Jülich: 2.027
Im Jahr des Erscheinens des Artikels in den Rur-Blumen, also im März 1927, zählt Hottorf 495 Einwohner.
Quelle: Rur-Blumen, Nr. 10 vom 5.3.1927, Unsere Heimat im 18. Jahrhundert im Spiegel eines Tagebuches von Adolf Fischer